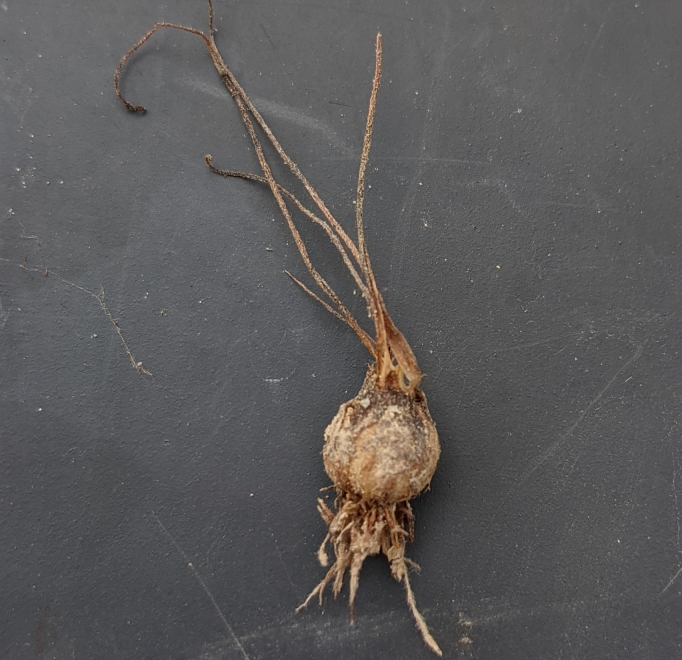Oliver Gluchs Welt der Fleischfressenden Pflanzen oder: "Was Sie schon immer einmal über Fettkraut wissen wollten" |
| Impressum |

| Startseite | Vorkommen | Beutetiere | Arten | Pflanzenkauf | Andere Karnivoren | Infos über Karnivoren | über mich |
Pinguicula medusina Zamudio & Studnička (2000)Auf
einer botanischen Kakteenexkursion 1977 sammelten Alfred Lau zusammen
mit den beiden tschechischen Kakteenexperten Jan Rija und Rudolf Subik
Pflanzen einer
Fettkrautsippe, die im Gebirge Sierra Madre del Sur auf Gipshügeln nahe
der Gemeinde Santiago
Juxtlahuaca
im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Einige Pflanzen wurden dann unter
anderem an den botanischen Garten der Karls-Universität in Prag und an
den botanischen Garten in Linz geschickt. Während die Pflanzen in Prag
eingingen, war der botanische Garten in Linz erfolgreich mit der Kultur
und verteilte Pflanzen unter dem Namen Pinguicula 'alfredae'
an andere botanische Gärten und Fettkrautliebhaber. Allerdings konnte
in den Folgejahren nicht geklärt werden, ob es sich bei der
Sippe von Santiago Juxtlahuaca um P. heterophylla
oder um eine eigenständige neue Art handelt. 1998 und 1999 wurden
vom mexikanischen Botaniker Sergio Zamudio verschiedene Exkursionen
unternommen, um mehr über die Pflanzen und das Habitat in Erfahrung zu
bringen. Gleichzeitig studierte der tschechische Botaniker Miloslav
Studnička im Botanischen Garten in Liberec (Tschechien) kultivierte
Pflanzen, um deren Identität zu klären. In Jahr 2000 kamen dann Zamudio
und
Studnička zu dem Schluß, dass sich die Sippe in mehreren Eigenschaften
von P. heterophylla unterscheidet und beschrieben
die Sippe als neue Art unter dem Namen Pinguicula medusina.
Der Name der Art bezieht sich auf den Kopf der Medusa aus der
griechischen Mythologie, da die beiden Autoren bei Form und Aussehen
der
Sommerrosette von P. medusina Ähnlichkeiten mit den
Schlangenhaaren der Medusa sahen.
P. medusina wächst
auf nach Osten und Norden ausgerichteten Gipshügeln in 1650 bis 1700 m
ü. M. Die vorherrschende Vegetation ist ein tropischer
(während der Trockenzeit) laubabwerfender Wald, lokal "bosque tropical
caducifolio" genannt. Neben locker stehenden kleinen Bäumen, Büschen,
Sträuchern und Gräsern kommt am Standort noch eine kleine
Palmen-
und eine
Begonien-Art vor.
P. medusina gehört
zum tropisch-heterophyllen Wuchstyp. Während der Trockenzeit (etwa ab
Dezember) bildet die Art eine Winterrosette in Form einer Zwiebel. Die
Winterrosette besteht aus 70 bis 90 nicht karnivoren, dickfleischigen
lanzettlich bis schmal lanzettlichen, spitz zulaufenden Blättern, die 8
bis 23 mm lang und 1,5 bis 3,5 mm breit werden. Die äußeren Blätter der
Winterrosette sind vertrocknet und sind seitlich behaart. Diese Blätter
umschließen die noch aktiven Blätter der Winterrosette und bilden eine
pergamentartige Hülle. Während der Trockenperiode scheint die
Winterrosette nicht weiter zu wachsen. Die zwiebelartige Winterrosette
sitzt bis mehrere Zentimeter tief im Gipssubstrat.
P. medusina bildet 2 Formen von
karnivoren Blättern aus und ist dementsprechend anisophyll. Gegen Ende
Mai werden die ersten karnivoren Blätter gebildet. Die 2 bis
5 Blätter dieses Blatttyps haben eine länglich-eiförmige
bis länglich-lanzettliche Form und sind
2 bis 4 cm lang und 3 bis 7,5 mm an der breitesten Stelle. Die Blätter
liegen flach auf dem Substrat an, sind meist dunkelgrün bis
rötlich-baun gefärbt und sind auf der Blattoberseite dicht mit
sitzenden und gestielten Drüsenhaaren besetzt. Danach werden die
Blätter des zweiten Blattyps gebildet. Diese Rosette besteht aus 6 bis
12 lanzettlich-linealisch geformten Blättern, die 7 bis 19 cm
lang und 1,5 bis 3,5 mm an der breitesten Stelle nahe der Blattbasis
werden. Der Blattrand ist stark nach unten gebogen. Die Blätter wachsen
zuerst aufrecht, neigen sich mit der Zeit dann immer mehr zum Substrat.
Neben der gerativen Vermehrung über Samen kann sich P. medusina auch
vegetativ vermehren. An etwa 70 bis 80% der Blätter bilden sich am
Blattende kleine Tochterpflanzen, die während des Wachstums auch schon
Wurzeln ausbilden und sich dann nach dem Absterben des
Blattes im Substrat verankern und sich von der Mutterpflanze
trennen. Bei im Herbst gebildeten Tochterpflanzen kommt es oft vor,
dass sich die Blätter der Mutterpflanze vor dem Vertrocknen nicht mehr
nach unten neigen, und so bilden die Tochterpflanzen noch an
dem vertrocknenden Blatt der Mutterpflanze eine zwiebelartige
Winterrosette aus. Da diese Winterrosette während der Trockenperiode am
vertrockneten Blatt hängen bleibt, kann diese nicht weggeweht oder bei
stärkerem Regen weggespült werden und kann sich nach einsetzender
Regenzeit im nächsten Frühjahr mit den neugebildeten Wurzeln im
Gipssubstrat verankern.
P. medusina blüht
von Anfang Juni bis Mitte Juli. Die Pflanzen bilden 1 bis 3 Blüten aus.
Der Blütenstil ist 4 bis 14 cm lang, olivgrün, bräunlich oder rotbraun
gefärbt und dicht mit Drüsenhaaren besetzt. Die Blütenkrone besteht aus
zwei Lippen mit fast gleichgroßen Kronblättern. Die Petalen
der Oberlippe sind länglich bis schmal eiförmig mit abgerundetem bis
gestutztem Blattende, 5 bis 8 mm lang und 2,5 bis 5 mm breit. Die
Petalen der Unterlippe sind 5 bis 9 mm lang und 2,5
bis 5
mm breit. Die Kronblätter überlappen sich nicht. Die Farbe der Petalen
variiert zwischen weiß und weiß mit
violettem Rand. Auf der Oberseite sind die Kronblätter von der
Blattmitte bis zum Kronröhreneingang dicht mit weißen Härchen besetzt.
Auf der Unterseite der Petalen sind vereinzelt Drüsenhaare vorhanden.
Die Basis des mittleren Kronblatts der Unterlippe weist einen
grüngelblichen Fleck auf, der sich auch etwas in die Kronröhre
fortsetzt. Die Kronröhre hat eine zylindrische Form, die sich zum Ende
hin verjüngt, und ist 6 bis 9 mm lang. Die Kronröhre hat eine
dunkelviolette Farbe mit leichter parallel verlaufender Aderung, wobei
die Farbe zum Sporn hin weißlich wird. Die
Außenseite der Kronröhre ist mit Drüsenhaaren besetzt. An die Kronröhre
schließt sich der fast zylinderförmige, 3 bis 5 mm lange Sporn an. Der
Sporn ist hellgrün bis olivgrün gefärbt (die Autoren geben
fälschlicherweiße die Farbe des Sporns mit weiß an) und am Ende
rundlich und manchmal leicht verdickt.
Manche
Autoren sehen P. medusina nur als eine Variante von
P. heterophylla an. Allerdings
unterscheidet sich das Habitat und die klimatischen Verhältnisse am
Standort deutlich von den bekannten Habitaten von
P.
heterophylla. Weitere Unterscheidungsmerkmale liegen laut Zamudio
und
Studnička in
der
Größe und Form der Kronblätter, der Überlappung der Petalen der
Unterlippe (nur bei P. heterophylla vorhanden), der
Ausfärbung der
Petalen, der Form
und Größe der Kronröhre sowie der Zeitpunkt der Blüte. Die Ausbildung
von
Tochterpflanzen am Blattende von Sommerblättern ist allerdings eine
Eigenschaft, die man auch bei Populationen von P. heterophylla
beobachten kann, allerdings ist der Prozentsatz an Blättern, die
Tochterpflanzen bilden, sehr viel geringer als bei P. medusina.
Bei der Kultur von P. medusina ist darauf zu achten, dass man die sich im Substrat befindenden Winterrosetten recht trocken kultiviert, sonst besteht die Gefahr, dass die Pflanzen verfaulen. Ab April/Mai kann man das Substrat etwas feuchter halten, sobald die ersten Sommerblätter aus der Winterrosette erscheinen. Während der Sommermonate sollte man die Pflanzen feucht halten, allerdings ist eine dauerhafte Kultur im Anstauverfahren nicht zu empfehlen. Als Substrat ist Gips nicht unbedingt notwendig. Die Kultur einem gut durchlüfteten (grobporigen) mineralischen Substrat zeigte sehr gute Kulturerfolge. Ab Oktober sollte man die Wassergaben wieder reduzieren und nach Ausbildung der Winterrosette sollten die Pflanzen wieder recht trocken kultiviert werden. |